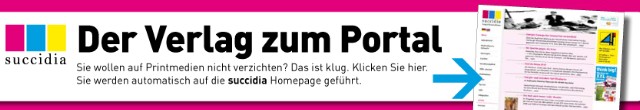|
Mistel - Bekämpfen oder schützen?
Mistel - Bekämpfen oder schützen?Aktuelles zu einem zunehmenden ProblemWährend die Mistel bedeutsame Nutzungen in der Naturheilkunde erfährt und in der Vergangenheit meist verehrt wurde oder gar heilig war, entsteht in letzter Zeit der Eindruck, dass ihre Schäden an Bäumen zunehmen und man sie bekämpfen muss. Für eine solche mögliche Zunahme können verschiedene Ursachen verantwortlich sein, woraus auch bestimmte Handlungsempfehlungen abzuleiten sind.
Die Weißbeerige Mistel (Viscum album) ist ein wintergrüner Strauch mit kugeliger Krone von maximal etwa 1,5 m Durchmesser in den Kronen der Wirtsbäume. Sie wurzelt nicht im Boden, sondern auf Ästen von Bäumen, wo sie den Wasserhaushalt des Wirtsbaumes anzapft. Es sind über 450 Baumarten /-unterarten als Wirtspflanzen bekannt, auf denen die Weißbeerige Mistel parasitiert. Interaktion mit dem Wirtsbaum
Ab März /April beginnen die Mistelsamen bei Temperaturen von 8 – 10 °C zu keimen, die optimale Temperatur liegt bei 15 – 20 °C. Wärmere Frühjahre wirken sich also günstig aus. Eine wesentlich größere Rolle spielen allerdings ausreichende Lichtverhältnisse. So können Schnittmaßnahmen die Mistel-Etablierung fördern. Die grüne Keimwurzel (eines an einem Wirtszweig klebenden Samens) biegt sich zur Wirtsrinde hin, bei Erreichen einer geeigneten Keimgrundlage drückt sich ihre Spitze an die Wirtsrinde und verbreitert sich durch seitliches Wachstum zu einer Haftscheibe. Dabei wird eine viskose Flüssigkeit abgeschieden, die als Klebstoff dient, verhärtet und den Keimling an der Unterlage festhält. Ökologie und Ausbreitung
Da die Mistel zur Fotosynthese selbst befähigt ist und daher keine Assimilate des Wirtes benötigt, gilt sie als Hemiparasit. Durch den direkten Anschluss an die Wasserleitungsbahnen des Wirtes bezieht die Mistel Wasser und darin gelöste Nährsalze („Nährsalzparasit“). Sie hat gegenüber ihrem Wirt stets eine erhöhte Transpirationsrate, sodass das Wasser bevorzugt zu ihr geleitet wird. Selbst nach Laubabwurf des Wirtsbaumes kann die Mistel die Leitbahnen des Wirtes noch zur eigenen Wasserversorgung nutzen, bis dies durch Frost verhindert wird. Schäden am Wirtsbaum und ihre Verhinderung / Beseitigung Nach dieser Kurzübersicht zur Biologie und Ökologie der Mistel sollen nun nachfolgend die häufigsten Fragen der Praxis zum Mistelbefall beantwortet bzw. diskutiert werden. - Wie, wo, wann und mit welchen Folgen schädigt die Mistel ihren Wirtsbaum? - Nimmt die Ausbreitung der Misteln derzeit zu? - Schadet die Mistel dem Wirtsbaum durch Wasser- / Nährstoffentzug? - Wird die Vitalität des Wirtsastes / -baumes durch die Mistel vermindert? - Kommt es im Bereich des Mistelansatzes zur Holzfäule? - Ergeben sich Astbruchrisiken aus dem Gewicht der Mistel? - Müssen /sollten Misteln bekämpft werden? Tritt die Mistel massenhaft auf, so kann sie zu Schädigungen an Einzelbäumen oder Baumbeständen führen. Stadtbaumbestände sind lokal (bestimmte Baumarten) besonders starkem Mistelbefall ausgesetzt, durch den ihre Vitalität abnehmen kann – bis hin zum Absterben von Ästen, Kronenteilen und ganzen Bäumen. Nachteilig dabei ist, dass die meisten Stadtbäume (z. B. Linde, Ahorn, Pappel, Robinie) besonders mistelhold sind, i.d.R. stärkerem Stress als Waldbäume ausgesetzt sind und oft durch ihren Freistand beliebte Schlaf- und Rastplätze für Vögel darstellen. Verbreitet herrscht derzeit der Eindruck, dass der Mistelbefall an Stadtbäumen zunimmt. Ob dies zutrifft, ist allerdings nicht sicher nachzuweisen. Ursachen könnten dafür z.B. sein: - eine geringere Nutzung der Misteln für medizinische Zwecke als früher, - eine Konkurrenzstärkung der Misteln durch stärker verlichtete Baumkronen, - eine Konkurrenzstärkung der Misteln durch geschwächte Wirtsbäume infolge beispielsweise von Trockenstress, - eine Konkurrenzstärkung der Misteln infolge wärmerer Winter durch die immergrünen Blätter, - veränderte Lebensgewohnheiten der Mistel verbreitenden Vögel, z.B. häufigeres Überwintern in den Städten.
Der Wasser- und Nährstoffbedarf der Mistel bedeutet einen gewissen Verlust für den Ast / Baum. Solange ausreichend Wasser und Nährstoffe vorhanden sind und der Mistelbfall moderat ist (eine Mistel pro Zweig bzw. maximal 5 – 10 pro Baum), dürften diese Verluste aber vernachlässigbar sein. Bei starkem Befall, Trockenstress oder Nährstoffmangel allerdings wird es nicht mehr nebensächlich sein. Eigene Erhebungen zeigen, dass Äste/Bäume mit Misteln oft eine schlechtere Vitalität zeigen als unbefallene Äste desselben Baumes bzw. unbefallene Bäume. Fazit
Die Mistel ist ein ungemein faszinierendes Gehölz, vielleicht das ungewöhnlichste heimische überhaupt. Alleine dies sollte zu einem gewissen Respekt vor ihrer Lebensweise und etwas Toleranz gegenüber ihren Schäden an Wirtsbäumen führen. Während die Mistel in früheren Zeiten verbreitet eine verehrte und wertvolle Pflanze war, gibt es heute in einigen deutschen Großstädten sog. Mistelbekämpfungsstrategien. Hier stellt sich die Frage, ob die Verhältnismäßigkeit noch gewahrt bleibt. Man kann zunächst davon ausgehen, dass die Mistel eher selten ihren Wirt umbringen wird, denn damit entzieht sie sich selbst die Lebensgrundlage. Wirklich kritisch wird es eigentlich nur bei stark befallenen Hybridpappeln, bei denen sich aber sowieso die Frage stellt, ob sie die geeigneten Stadtbaumarten sind. Literatur
Grundmann, B.M.; Pietzarka, U.; Roloff, A., 2011: Viscum album L. (Weißbeerige Mistel). Enzyklopädie der Holzgewächse 59: 1-23. Foto: © Prof. Dr. Andreas Roloff |
L&M 6 / 2012
Das komplette Heft zum kostenlosen Download finden Sie hier: zum Download Der Autor:NewsSchnell und einfach die passende Trennsäule findenMit dem HPLC-Säulenkonfigurator unter www.analytics-shop.com können Sie stets die passende Säule für jedes Trennproblem finden. Dank innovativer Filtermöglichkeiten können Sie in Sekundenschnelle nach gewünschtem Durchmesser, Länge, Porengröße, Säulenbezeichnung u.v.m. selektieren. So erhalten Sie aus über 70.000 verschiedenen HPLC-Säulen das passende Ergebnis für Ihre Anwendung und können zwischen allen gängigen Herstellern wie Agilent, Waters, ThermoScientific, Merck, Sigma-Aldrich, Chiral, Macherey-Nagel u.v.a. wählen. Ergänzend stehen Ihnen die HPLC-Experten von Altmann Analytik beratend zur Seite – testen Sie jetzt den kostenlosen HPLC-Säulenkonfigurator!© Text und Bild: Altmann Analytik ZEISS stellt neue Stereomikroskope vorAufnahme, Dokumentation und Teilen von Ergebnissen mit ZEISS Stemi 305 und ZEISS Stemi 508ZEISS stellt zwei neue kompakte Greenough-Stereomikroskope für Ausbildung, Laborroutine und industrielle Inspektion vor: ZEISS Stemi 305 und ZEISS Stemi 508. Anwender sehen ihre Proben farbig, dreidimensional, kontrastreich sowie frei von Verzerrungen oder Farbsäumen. © Text und Bild: Carl Zeiss Microscopy GmbH |